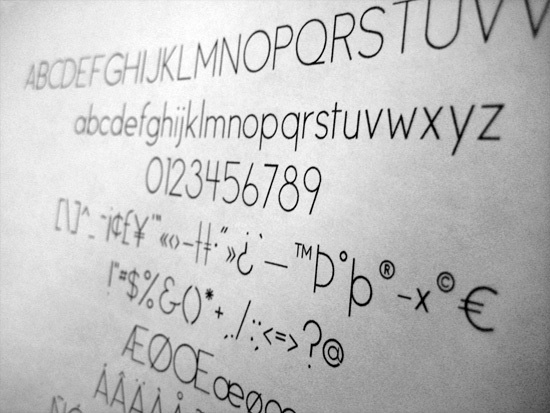
TradingDesk - am Donnerstag, 3. Januar 2013, 13:13
"Es ist einfach Unsinn, dass es zu wenig Geld gibt", sagt Birger Priddat, Wirtschaftsprofessor aus Witten/Herdecke, ruhig und bedacht: "Geld? Geld ist genügend da. Aber die Gelegenheit, es unkonventionell anzulegen, die ist selten."
Wie denn? Unkonventionell?
"Ja, unkonventionell", sagt Priddat, "sonst bringt es ja nix."
Der Professor beschreibt die Lage: Es gibt immer und überall Zauderer und Zitterer, die auf ihrem Geld sitzen. Krise und Konjunkturschwäche lassen die Leute besonders vorsichtig werden, und wenn es zu arg kommt, die Visionen, das Unkonventionelle, mit dem sich was extra verdienen lässt, allzu dünn gesät sind, dann klammern die Leute umso mehr. "Die meisten verzichten dann völlig darauf, Gewinne mitzunehmen." Fatal? Muss nicht sein, sagt Priddat, denn das bedeutet für alle mit Visionen auch: "Das Geld wartet auf uns, es ist in Wartestellung."
"Die meisten Leute geben ihr Geld konventionell aus - für Essen, ein Dach überm Kopf, Reisen, ein Auto, Konsum eben. Und Konventionalität bestimmt auch Investitionen." Eine Investition ist aber etwas anderes als Konsum. Denn erstens: Beim Investitionsakt kann das ganze schöne Geld verschlissen werden. Und zweitens: Ich gebe das Geld jemand anderem, und dem muss ich vertrauen. Ich leihe mir als Investor die Vision des anderen - der eine hat das Geld, der andere die Idee.
Das also ist, nochmals in Kürze, die Formel für den Wechselkurs: neues Kapital = Vertrauen x Vision. Für die meisten, die heute Geld haben, ist das Resultat der Gleichung eine Fremdwährung. Vertrauen ist kein Blindflug. Es baut auf Wissen und Erfahrung ebenso wie auf die Einsicht, dass zu ihm auch ein Quäntchen Risiko gehört. Wo die Summe des Vertrauens null ist, lässt sich keine Vision multiplizieren.
Wie denn? Unkonventionell?
"Ja, unkonventionell", sagt Priddat, "sonst bringt es ja nix."
Der Professor beschreibt die Lage: Es gibt immer und überall Zauderer und Zitterer, die auf ihrem Geld sitzen. Krise und Konjunkturschwäche lassen die Leute besonders vorsichtig werden, und wenn es zu arg kommt, die Visionen, das Unkonventionelle, mit dem sich was extra verdienen lässt, allzu dünn gesät sind, dann klammern die Leute umso mehr. "Die meisten verzichten dann völlig darauf, Gewinne mitzunehmen." Fatal? Muss nicht sein, sagt Priddat, denn das bedeutet für alle mit Visionen auch: "Das Geld wartet auf uns, es ist in Wartestellung."
"Die meisten Leute geben ihr Geld konventionell aus - für Essen, ein Dach überm Kopf, Reisen, ein Auto, Konsum eben. Und Konventionalität bestimmt auch Investitionen." Eine Investition ist aber etwas anderes als Konsum. Denn erstens: Beim Investitionsakt kann das ganze schöne Geld verschlissen werden. Und zweitens: Ich gebe das Geld jemand anderem, und dem muss ich vertrauen. Ich leihe mir als Investor die Vision des anderen - der eine hat das Geld, der andere die Idee.
Das also ist, nochmals in Kürze, die Formel für den Wechselkurs: neues Kapital = Vertrauen x Vision. Für die meisten, die heute Geld haben, ist das Resultat der Gleichung eine Fremdwährung. Vertrauen ist kein Blindflug. Es baut auf Wissen und Erfahrung ebenso wie auf die Einsicht, dass zu ihm auch ein Quäntchen Risiko gehört. Wo die Summe des Vertrauens null ist, lässt sich keine Vision multiplizieren.
TradingDesk - am Montag, 1. September 2003, 23:09
Jakob Fugger war mächtiger als George Bush.
Politisch korrekt – aber grundfalsch – ist die Ansicht des Bildungsbürgers, dass sich zum Ende des Mittelalters, irgendwann zur Mitte des 14. Jahrhunderts, der schöne Geist einfach so über den gewohnten Mief erhoben hätte. Die Renaissance, das Zeitalter des frühen Kapitalismus, der Kunst, der neuen Wissenschaft, der Anfang vom Ende des Aberglaubens, all das fiel nicht vom Himmel, sondern war das Ergebnis von null Luft – im Wortsinn.
Die Entdeckung Amerikas, die Conquista, die frühen Bankiers, die Expeditionen in fremde Kontinente, die Erschließung der Welt - sie alle sind Wirkung, nicht Ursache, eines fundamentalen Ereignisses. Die risikofreudigste Epoche der Geschichte, erzählt Bernd Roeck, Historiker der Universität Zürich, beginnt im Jahr 1348, dem Jahr der Großen Pest. "Was da passierte, lässt sich schwer beschreiben und vergleichen. Um eine Vorstellung zu bekommen, was 1348 geschah, müsste man sich überlegen, welche Folgen ein flächendeckender Angriff mit Neutronenbomben auf Europa haben würde", sagt Roeck. Die modernen Massenvernichtungswaffen töten Menschen und Tiere – aber lassen Häuser und Fabriken, Büros und Anlagen unversehrt. Die Große Pest tötete zwei Drittel der europäischen Bevölkerung. Europa war dicht besiedelt, am Rande der Überbevölkerung. Was nach dem Grauen blieb, war, so erzählt Roeck, vor allem "ungeheuer viel Kapital. Das ganze Geld, der Besitz der Toten war übrig geblieben. Das führte zu gewaltigen Vermögensumschichtungen." Der Beginn der neuen Zeit ist eine Katastrophe. Was sie hinterlässt, verlangt dringend nach neuen Ideen. Visionen werden gemacht. Sie müssen gemacht werden, weil sonst auch die Überlebenden nichts mehr hätten, worauf sie bauen können.
Die verwaisten Vermögenswerte sind es, die die Banken der Medici formen. Ihre Macht, die sie in der Renaissance ausüben, gibt den Impuls an die großen Investoren weiter, an die Handelshäuser, die die Fugger groß machen. Jakob Fugger der Reiche war mächtiger als George Bush. Und er setzte, wie alle, die nach der Großen Pest die riesigen Vermögen neu ordneten, im großen Stil und mit hohem Risiko auf neue Entwicklungen, auf die Visionen ihrer Zeit. Alles auf der Grundlage der Pest.
Italien wird zur Heimat der neuen großen Investoren – Venedig, Verona, Bologna sind die Silicon Valleys von damals. Die Unternehmen sind alles andere als risikofrei. "Man braucht sehr viel Geld, um eine Galeere, mit der sich Handelsgüter aus dem Nahen Osten nach Venedig bringen lassen, auszustatten. Seide, Baumwolle und Gewürze bringen viel Geld – Gewinnspannen von 70, 80 Prozent – aber auch ein enormes Risiko. Deshalb beginnen die Venezianer, das Risiko auf Konsortien zu verteilen und entwickeln Versicherungen."
Politisch korrekt – aber grundfalsch – ist die Ansicht des Bildungsbürgers, dass sich zum Ende des Mittelalters, irgendwann zur Mitte des 14. Jahrhunderts, der schöne Geist einfach so über den gewohnten Mief erhoben hätte. Die Renaissance, das Zeitalter des frühen Kapitalismus, der Kunst, der neuen Wissenschaft, der Anfang vom Ende des Aberglaubens, all das fiel nicht vom Himmel, sondern war das Ergebnis von null Luft – im Wortsinn.
Die Entdeckung Amerikas, die Conquista, die frühen Bankiers, die Expeditionen in fremde Kontinente, die Erschließung der Welt - sie alle sind Wirkung, nicht Ursache, eines fundamentalen Ereignisses. Die risikofreudigste Epoche der Geschichte, erzählt Bernd Roeck, Historiker der Universität Zürich, beginnt im Jahr 1348, dem Jahr der Großen Pest. "Was da passierte, lässt sich schwer beschreiben und vergleichen. Um eine Vorstellung zu bekommen, was 1348 geschah, müsste man sich überlegen, welche Folgen ein flächendeckender Angriff mit Neutronenbomben auf Europa haben würde", sagt Roeck. Die modernen Massenvernichtungswaffen töten Menschen und Tiere – aber lassen Häuser und Fabriken, Büros und Anlagen unversehrt. Die Große Pest tötete zwei Drittel der europäischen Bevölkerung. Europa war dicht besiedelt, am Rande der Überbevölkerung. Was nach dem Grauen blieb, war, so erzählt Roeck, vor allem "ungeheuer viel Kapital. Das ganze Geld, der Besitz der Toten war übrig geblieben. Das führte zu gewaltigen Vermögensumschichtungen." Der Beginn der neuen Zeit ist eine Katastrophe. Was sie hinterlässt, verlangt dringend nach neuen Ideen. Visionen werden gemacht. Sie müssen gemacht werden, weil sonst auch die Überlebenden nichts mehr hätten, worauf sie bauen können.
Die verwaisten Vermögenswerte sind es, die die Banken der Medici formen. Ihre Macht, die sie in der Renaissance ausüben, gibt den Impuls an die großen Investoren weiter, an die Handelshäuser, die die Fugger groß machen. Jakob Fugger der Reiche war mächtiger als George Bush. Und er setzte, wie alle, die nach der Großen Pest die riesigen Vermögen neu ordneten, im großen Stil und mit hohem Risiko auf neue Entwicklungen, auf die Visionen ihrer Zeit. Alles auf der Grundlage der Pest.
Italien wird zur Heimat der neuen großen Investoren – Venedig, Verona, Bologna sind die Silicon Valleys von damals. Die Unternehmen sind alles andere als risikofrei. "Man braucht sehr viel Geld, um eine Galeere, mit der sich Handelsgüter aus dem Nahen Osten nach Venedig bringen lassen, auszustatten. Seide, Baumwolle und Gewürze bringen viel Geld – Gewinnspannen von 70, 80 Prozent – aber auch ein enormes Risiko. Deshalb beginnen die Venezianer, das Risiko auf Konsortien zu verteilen und entwickeln Versicherungen."
TradingDesk - am Montag, 1. September 2003, 22:18
Endlich! Endlich hält mal einer den Amis den Spiegel vor. Ein amüsanter Dokumentarfilm ist es geworden, frech, komisch und beängstigend. Er handelt vom Waffenwahn in den USA. Von der gefährlichen Wut jener Teens, die schon in der Schule zu Verlierern abgestempelt werden. Und davon, dass einen jederzeit ein paranoider Bürger erschiessen kann, wenn man an einer amerikanischen Wohnungstür klingelt.
«Bowling for Columbine» hat in der Schweiz bereits über 150.000 Zuschauer angezogen, ein sensationeller Erfolg für einen Dokumentarfilm. Beim Abspann denkt jeder: Die spinnen, die Amis. Und mancher vergisst in seiner Begeisterung, wer den Film gemacht hat: Michael Moore aus Flint, Michigan, USA.
Oops. Amerika ist eben wie ein Warenhaus. Es bietet Trouvaillen. Und es bietet viel Schund, aus dem wir dann unsere Amerika-Klischees fertigen: Der doofe Yankee stopft sich voll mit Junk Food, steht auf den elektrischen Stuhl, hört auf bigotte TV-Prediger, folgt einem subintellektuellen Präsidenten, verehrt Hollywood-Grinsgesichter wie Tom Cruise und zieht sich den Styropor-Sound von Britney Spears rein. Total daneben! Und nächstens führt er wieder mal Krieg.
Doch selbst die zornigsten Kritiker einer Irak-Invasion würden nicht so weit gehen, ihre Tom-Waits-Platten aus dem Fenster zu schmeissen und stattdessen irakische Ud-Musik aufzulegen. Es fällt eben schwer, auf Amerikas beste Seiten zu verzichten, selbst wenn die schlechten nerven. Wer die Nase voll hat von Amerika, folgt dem andern Amerika: Es geht gar nicht anders. Gegenkultur nährt sich heute massgeblich aus den Vereinigten Staaten.
Denn die bissigste USA-Kritik kommt aus den USA: Keine Band der Welt griff George W. Bush so hart an wie Public Enemy in «Son of a Bush». Keiner spiesste den Medien-Infantilismus so clever auf wie der New-Yorker Autor Jonathan Franzen in seinen Essays. Und die süsslichen Familien-Idyllen der Republikaner münden stracks in ätzende Kinodramen wie «American Beauty» – respektive in giftige Trickfilm-Serien wie «South Park» und «Die Simpsons».
Die amerikanische Vormachtstellung in der Kultur drückt sich in deren Doppelnatur aus: Sie bietet Angriffsfläche; und sie bietet Raum zu bewundern. Sie durchdringt uns effizient; und sie greift sich selber an: Der mächtige amerikanische Mainstream macht auch jene gross, die gegen ihn schwimmen. Bei seinem Auftritt jüngst im Hallenstadion Zürich begann Techno-Popper Moby plötzlich, den US-Präsidenten zu verhöhnen. Dann rief er: «Ich schäme mich, Amerikaner zu sein!» Und 10.000 Menschen schrien: «Yeah!»
In der Schweiz strömen drei Viertel der Kinobesucher in amerikanische Filme, jeder zweite Song in unseren Hitparaden stammt aus den USA. An keiner anderen Nation hat der Rest der Welt so intensiv teil, keine liefert so viele Bilder; und die besten Bilder, um es zu hassen, liefert Amerika gleich mit. Hollywood investiert gern einige Millionen pro Jahr, um respektlos auf sich und die US-Gesellschaft zu schauen. Noch jeder Krieg Amerikas wurde mit einer dreisten Farce bestraft, zuletzt der Golfkrieg mit «Three Kings». Und mancher Skandal wird erst dank Hollywood breit bewusst: die Lügen der Tabak-Multis durch «The Insider»; Umweltvergiftung durch «Erin Brockovich», worin Julia Roberts als Trash-Tussi einen Giftskandal aufdeckt. Der Film fand in der Schweiz 570.000 Kinozuschauer. Da können unsere Grünen jahrzehntelang Stand-Aktionen durchführen – ein einziger Hollywood-Film löst mehr ökologische Aha-Erlebnisse aus.
Volksverdummung durch Hollywood? Das ist die Projektion eines Europas, welches seit Jahren keine heissen Politdramen mehr produziert, aber immer öfter Massenware à la Hollywood. Mit der Folge, dass die Amerikaner nun beides besser können.
Das Geheimnis der kulturellen Supermacht liegt in ihrer unideologischen Beweglichkeit. Schon in seinen Geburtsjahren am Anfang des 20. Jahrhunderts musste ihr Unterhaltungsbusiness aufs bunte Publikum einer Einwanderer-Gesellschaft zielen: Breite Verständlichkeit wurde früh zur Selbstverständlichkeit, und früh auch setzte sich die angelsächsische Haltung durch, dass Kritik und Konsum, Elite und Entertainment, Intellekt und Leichtfüssigkeit kein Widerspruch sind, im Gegenteil. Der Optimismus-Wahn der amerikanischen Traumfabriken hat immer auch grosse tragische Figuren und Stoffe provoziert.
Wer, bitte schön, schreibt derzeit die wegweisenden Gesellschaftsromane? Autoren der Big-Mac-Nation. Philip Roth, Michael Chabon, Paul Auster, John Updike, Stephen L. Carter: Sie alle legten
in den letzten Monaten Werke vor, die sich keine künstlerischen Einschränkungen gefallen lassen und doch süffig erzählt sind. Sie halten Geschichte und politisches Umfeld präsent, meiden platten Ich-Kult – und schaffen es erst noch, unsere Bestsellerlisten zu erobern. Trotz backsteindicker Umfänge.
Vorbei die Zeiten, da europäische Denker Gegenentwürfe zu bieten hatten und damit auf breiter Front ankamen. Im Kalten Krieg drohte Mitteleuropa zum Terrain der grossen Konfrontation zu werden; die Gefahr regte in seinen besten Köpfen Widerspruchsgeist. Hiesige Intellektuelle schöpften aus dem virulenten Erbe der Frankfurter Schule, schöpften aus Adorno und Marcuse. Der Filmer Godard formulierte die Bildsprache des Kinos. Der Philosoph Sartre widmete sich den Bedingungen menschlicher Existenz, der Historiker Foucault definierte die Zusammenhänge von Sexualität und Macht völlig neu.
Tot sind sie alle. Und unser Jean Ziegler repetiert seit Jahrzehnten den gleichen Anti-Banken-Sermon. Dass US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld nun öffentlich über «das alte Europa» herzog, lockte zwar prompt die Grossintellektuellen wie Habermas und Derrida aus der Reserve: Sie präsentierten Europa als Hort von Vernunft und Völkerrecht. Aber will man sie hören? Wir nehmens zur Kenntnis, schalten den TV ein und ziehn uns «Die Osbournes» rein. Reality TV aus Beverly Hills – göttlicher Trash.
Europa ist Amerika in Hassliebe verbunden – seit Jahrhunderten. Schon die Romantiker verfluchten die Bürger der Neuen Welt als seelenlose Geldscheffler und schauten gleichzeitig neidisch auf die Pioniere von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. Noch um 1910 hegten hiesige Bürger den Dünkel, amerikanische Kultur brauche man nicht zur Kenntnis zu nehmen; ein paar Jahre später lag Europa Charlie Chaplin zu Füssen. In den Fifties verfluchte man die amerikanische Kommunistenhatz und sehnsüchtelte mit Autor Jack Kerouac vom Bohemien-Leben «On the Road», in den Sixties hoffte man zur Musik von Bob Dylan auf Frieden in Vietnam, in den Seventies labte man sich daran, wie Robert Altman im Film «Nashville» die US-Gesellschaft demontierte, pünktlich zum 200-Jahre-Jubiläum der Vereinigten Staaten. Und wer heute über die billig-lasziven R&B-Sängerinnen auf MTV klagt, hält sich an Erykah Badu, den feministischen Gegenentwurf made in USA.
Weil die USA überhaupt noch eine öffentliche Moral hochhalten, sind Verstösse gegen diese so wirkungsvoll. Nulltoleranz gegenüber Drogen – das belebt die Protestlust. Todesstrafe – das weckt Gegenhass. Und der Tugenddruck der amerikanischen Political Correctness hat dafür gesorgt, dass uns Amerika die wahnwitzigsten Provokateure zu bieten hat. Die Deutschtümler Rammstein wirken im Vergleich zu Schockrocker Marilyn Manson nur dumpf. In den USA spielte Rapper Eminem jahrelang die sexistische Wildsau, spuckte auf die amerikanischen Werte, veräppelte den amerikanischen Traum – und träumte ihn doch. Heute macht sich Eminem im Film «8 Mile» zum Aushängeschild einer Lebensphilosophie à la Rockefeller: Die Welt ist gross, pack deine Chance!
Der Rebell ist zum Integrierten geworden, wie es schon vielen seit Elvis Presley passierte. Doch keine Bange: Der nächste Aussenseiter, der die dunklen Seiten der westlichen Welt anklagt, kommt bestimmt. Und ganz bestimmt kommt er aus den USA.
Die grössten Idole sind heute jene, die Amerikas Spannungen in sich bündeln. Südstaatenstar Johnny Cash ist zum Liebling hiesiger Freitagtaschenträger geworden. Die setzen ihren Namen unter ein Rund-Mail gegen Washingtons Kriegspläne; gehen hin und kaufen sich Cashs neue CD «The Man Comes Around»; überhören wiederum Cashs pathetischen Patriotismus: «Ich liebe dieses Land, der 11. September war ein Schlag gegen unsere Moral.» Und nehmen lieber den Johnny Cash, der dem kommerziellen Nashville den Stinkefinger zeigt und mal im Gefängnis sass. Sein Gefrömmel? Verzeiht der gottlos aufgeschlossene Europäer, wie er es keinem europäischen Künstler verzeihen würde. Amerika ist eben auch so weit weg, dass Details unwichtig werden. Protestsängerin Ani DiFranco wird auf ihren Europa-Tourneen immer noch als die Vorzeigelesbe gefeiert – drei Jahre nach ihrer Hochzeit mit ihrem Tontechniker.
Der eine zimmert sich aus Easy-Rider-Motorrad, Südstaatenflagge und genieteter Lederjacke ein nostalgisches Freiheit-und-Abenteuer-Amerika. Der andere fabuliert sich aus schwulen House-DJs, Tarantino-Filmen und den bunten Seattle-Anti-Globalisierern ein multikulturelles Amerika der Hipness, das es nicht gibt. Und was serviert uns der Chor Laltracosa demnächst in Bern? Ernsthafte Werke von Musikklassikern wie Charles Ives, John Cage, Charles Mingus und George Gershwin unter dem Titel: «Das Andere Amerika».
© FACTS/ tamedia ag
«Bowling for Columbine» hat in der Schweiz bereits über 150.000 Zuschauer angezogen, ein sensationeller Erfolg für einen Dokumentarfilm. Beim Abspann denkt jeder: Die spinnen, die Amis. Und mancher vergisst in seiner Begeisterung, wer den Film gemacht hat: Michael Moore aus Flint, Michigan, USA.
Oops. Amerika ist eben wie ein Warenhaus. Es bietet Trouvaillen. Und es bietet viel Schund, aus dem wir dann unsere Amerika-Klischees fertigen: Der doofe Yankee stopft sich voll mit Junk Food, steht auf den elektrischen Stuhl, hört auf bigotte TV-Prediger, folgt einem subintellektuellen Präsidenten, verehrt Hollywood-Grinsgesichter wie Tom Cruise und zieht sich den Styropor-Sound von Britney Spears rein. Total daneben! Und nächstens führt er wieder mal Krieg.
Doch selbst die zornigsten Kritiker einer Irak-Invasion würden nicht so weit gehen, ihre Tom-Waits-Platten aus dem Fenster zu schmeissen und stattdessen irakische Ud-Musik aufzulegen. Es fällt eben schwer, auf Amerikas beste Seiten zu verzichten, selbst wenn die schlechten nerven. Wer die Nase voll hat von Amerika, folgt dem andern Amerika: Es geht gar nicht anders. Gegenkultur nährt sich heute massgeblich aus den Vereinigten Staaten.
Denn die bissigste USA-Kritik kommt aus den USA: Keine Band der Welt griff George W. Bush so hart an wie Public Enemy in «Son of a Bush». Keiner spiesste den Medien-Infantilismus so clever auf wie der New-Yorker Autor Jonathan Franzen in seinen Essays. Und die süsslichen Familien-Idyllen der Republikaner münden stracks in ätzende Kinodramen wie «American Beauty» – respektive in giftige Trickfilm-Serien wie «South Park» und «Die Simpsons».
Die amerikanische Vormachtstellung in der Kultur drückt sich in deren Doppelnatur aus: Sie bietet Angriffsfläche; und sie bietet Raum zu bewundern. Sie durchdringt uns effizient; und sie greift sich selber an: Der mächtige amerikanische Mainstream macht auch jene gross, die gegen ihn schwimmen. Bei seinem Auftritt jüngst im Hallenstadion Zürich begann Techno-Popper Moby plötzlich, den US-Präsidenten zu verhöhnen. Dann rief er: «Ich schäme mich, Amerikaner zu sein!» Und 10.000 Menschen schrien: «Yeah!»
In der Schweiz strömen drei Viertel der Kinobesucher in amerikanische Filme, jeder zweite Song in unseren Hitparaden stammt aus den USA. An keiner anderen Nation hat der Rest der Welt so intensiv teil, keine liefert so viele Bilder; und die besten Bilder, um es zu hassen, liefert Amerika gleich mit. Hollywood investiert gern einige Millionen pro Jahr, um respektlos auf sich und die US-Gesellschaft zu schauen. Noch jeder Krieg Amerikas wurde mit einer dreisten Farce bestraft, zuletzt der Golfkrieg mit «Three Kings». Und mancher Skandal wird erst dank Hollywood breit bewusst: die Lügen der Tabak-Multis durch «The Insider»; Umweltvergiftung durch «Erin Brockovich», worin Julia Roberts als Trash-Tussi einen Giftskandal aufdeckt. Der Film fand in der Schweiz 570.000 Kinozuschauer. Da können unsere Grünen jahrzehntelang Stand-Aktionen durchführen – ein einziger Hollywood-Film löst mehr ökologische Aha-Erlebnisse aus.
Volksverdummung durch Hollywood? Das ist die Projektion eines Europas, welches seit Jahren keine heissen Politdramen mehr produziert, aber immer öfter Massenware à la Hollywood. Mit der Folge, dass die Amerikaner nun beides besser können.
Das Geheimnis der kulturellen Supermacht liegt in ihrer unideologischen Beweglichkeit. Schon in seinen Geburtsjahren am Anfang des 20. Jahrhunderts musste ihr Unterhaltungsbusiness aufs bunte Publikum einer Einwanderer-Gesellschaft zielen: Breite Verständlichkeit wurde früh zur Selbstverständlichkeit, und früh auch setzte sich die angelsächsische Haltung durch, dass Kritik und Konsum, Elite und Entertainment, Intellekt und Leichtfüssigkeit kein Widerspruch sind, im Gegenteil. Der Optimismus-Wahn der amerikanischen Traumfabriken hat immer auch grosse tragische Figuren und Stoffe provoziert.
Wer, bitte schön, schreibt derzeit die wegweisenden Gesellschaftsromane? Autoren der Big-Mac-Nation. Philip Roth, Michael Chabon, Paul Auster, John Updike, Stephen L. Carter: Sie alle legten
in den letzten Monaten Werke vor, die sich keine künstlerischen Einschränkungen gefallen lassen und doch süffig erzählt sind. Sie halten Geschichte und politisches Umfeld präsent, meiden platten Ich-Kult – und schaffen es erst noch, unsere Bestsellerlisten zu erobern. Trotz backsteindicker Umfänge.
Vorbei die Zeiten, da europäische Denker Gegenentwürfe zu bieten hatten und damit auf breiter Front ankamen. Im Kalten Krieg drohte Mitteleuropa zum Terrain der grossen Konfrontation zu werden; die Gefahr regte in seinen besten Köpfen Widerspruchsgeist. Hiesige Intellektuelle schöpften aus dem virulenten Erbe der Frankfurter Schule, schöpften aus Adorno und Marcuse. Der Filmer Godard formulierte die Bildsprache des Kinos. Der Philosoph Sartre widmete sich den Bedingungen menschlicher Existenz, der Historiker Foucault definierte die Zusammenhänge von Sexualität und Macht völlig neu.
Tot sind sie alle. Und unser Jean Ziegler repetiert seit Jahrzehnten den gleichen Anti-Banken-Sermon. Dass US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld nun öffentlich über «das alte Europa» herzog, lockte zwar prompt die Grossintellektuellen wie Habermas und Derrida aus der Reserve: Sie präsentierten Europa als Hort von Vernunft und Völkerrecht. Aber will man sie hören? Wir nehmens zur Kenntnis, schalten den TV ein und ziehn uns «Die Osbournes» rein. Reality TV aus Beverly Hills – göttlicher Trash.
Europa ist Amerika in Hassliebe verbunden – seit Jahrhunderten. Schon die Romantiker verfluchten die Bürger der Neuen Welt als seelenlose Geldscheffler und schauten gleichzeitig neidisch auf die Pioniere von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. Noch um 1910 hegten hiesige Bürger den Dünkel, amerikanische Kultur brauche man nicht zur Kenntnis zu nehmen; ein paar Jahre später lag Europa Charlie Chaplin zu Füssen. In den Fifties verfluchte man die amerikanische Kommunistenhatz und sehnsüchtelte mit Autor Jack Kerouac vom Bohemien-Leben «On the Road», in den Sixties hoffte man zur Musik von Bob Dylan auf Frieden in Vietnam, in den Seventies labte man sich daran, wie Robert Altman im Film «Nashville» die US-Gesellschaft demontierte, pünktlich zum 200-Jahre-Jubiläum der Vereinigten Staaten. Und wer heute über die billig-lasziven R&B-Sängerinnen auf MTV klagt, hält sich an Erykah Badu, den feministischen Gegenentwurf made in USA.
Weil die USA überhaupt noch eine öffentliche Moral hochhalten, sind Verstösse gegen diese so wirkungsvoll. Nulltoleranz gegenüber Drogen – das belebt die Protestlust. Todesstrafe – das weckt Gegenhass. Und der Tugenddruck der amerikanischen Political Correctness hat dafür gesorgt, dass uns Amerika die wahnwitzigsten Provokateure zu bieten hat. Die Deutschtümler Rammstein wirken im Vergleich zu Schockrocker Marilyn Manson nur dumpf. In den USA spielte Rapper Eminem jahrelang die sexistische Wildsau, spuckte auf die amerikanischen Werte, veräppelte den amerikanischen Traum – und träumte ihn doch. Heute macht sich Eminem im Film «8 Mile» zum Aushängeschild einer Lebensphilosophie à la Rockefeller: Die Welt ist gross, pack deine Chance!
Der Rebell ist zum Integrierten geworden, wie es schon vielen seit Elvis Presley passierte. Doch keine Bange: Der nächste Aussenseiter, der die dunklen Seiten der westlichen Welt anklagt, kommt bestimmt. Und ganz bestimmt kommt er aus den USA.
Die grössten Idole sind heute jene, die Amerikas Spannungen in sich bündeln. Südstaatenstar Johnny Cash ist zum Liebling hiesiger Freitagtaschenträger geworden. Die setzen ihren Namen unter ein Rund-Mail gegen Washingtons Kriegspläne; gehen hin und kaufen sich Cashs neue CD «The Man Comes Around»; überhören wiederum Cashs pathetischen Patriotismus: «Ich liebe dieses Land, der 11. September war ein Schlag gegen unsere Moral.» Und nehmen lieber den Johnny Cash, der dem kommerziellen Nashville den Stinkefinger zeigt und mal im Gefängnis sass. Sein Gefrömmel? Verzeiht der gottlos aufgeschlossene Europäer, wie er es keinem europäischen Künstler verzeihen würde. Amerika ist eben auch so weit weg, dass Details unwichtig werden. Protestsängerin Ani DiFranco wird auf ihren Europa-Tourneen immer noch als die Vorzeigelesbe gefeiert – drei Jahre nach ihrer Hochzeit mit ihrem Tontechniker.
Der eine zimmert sich aus Easy-Rider-Motorrad, Südstaatenflagge und genieteter Lederjacke ein nostalgisches Freiheit-und-Abenteuer-Amerika. Der andere fabuliert sich aus schwulen House-DJs, Tarantino-Filmen und den bunten Seattle-Anti-Globalisierern ein multikulturelles Amerika der Hipness, das es nicht gibt. Und was serviert uns der Chor Laltracosa demnächst in Bern? Ernsthafte Werke von Musikklassikern wie Charles Ives, John Cage, Charles Mingus und George Gershwin unter dem Titel: «Das Andere Amerika».
© FACTS/ tamedia ag
TradingDesk - am Samstag, 23. August 2003, 02:02